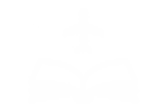40 Jahre Gasteig - Ein Jubiläum im Gasteig HP8
Noch heute erledige ich meine Wocheneinkäufe hin und wieder im Motorama, so dass der alte Gasteig über der Isar meinem Bewusstsein nie ganz entschwunden ist; und als ich einmal mehr im Motorama-Untergeschoss unterwegs war, stieß ich auf Plakate an den Wänden, die verkündeten, dass es am 12. November von 17:00 bis 21:00 Uhr eine Geburtstagsfeier mit Live-Aktionen, Workshops, Musik und Torte gab: Der Gasteig feierte sein 40jähriges Jubiläum!
Als ich mich im alten Gasteig-Gebäude umsah, stellte ich fest, dass alle Veranstaltungen nur im HP8-Ausweichquartier an der Brudermühlstraße stattfinden sollten und das "Fat Cat"-Kollektiv sich an den Jubiläums-Feierlichkeiten gar nicht beteiligte, mit keinem Konzert, keinem Vortrag, keinem Workshop, nichts. Schon eigenartig, denn vor seiner Stilllegung im Jahr 2019 war der alte Gasteig über 34 Jahre hinweg ein existierender und funktionierender Kulturbetrieb gewesen!
Doch zu den Jubiläumsfeierlichkeiten im Gasteig HP8 waren alle Münchnerinnen und Münchner bei freiem Eintritt eingeladen, auch das Münchner Kammerorchester (MKO) würde sich daran beteiligen, und im Saal X sollte es eine Zusammenführung von Musik, Literatur und darstellender Kunst geben.
Seit dem Sommerfest "Wolke 8" im Juni 2023 war ich nicht mehr im Gasteig HP8 gewesen, und nun bot sich mir die Zeit und Gelegenheit, mich an dem angekündigten Mittwoch im November dort einmal mehr bewusst umzusehen.
Das erste, was mir ins Auge fiel, war, dass der Bereich zwischen der Straße und dem Campus mit seinen Gebäuden auf der tiefgelegten Ebene deutlich aufgeräumter und bereinigter wirkte als vor fast zweieinhalb Jahren, und dass er im wahren Sinn des Wortes erleuchtet war: Große Flutlichtscheinwerfer tauchten das gesamte Areal und auch die einzelnen Gebäude in ein strahlendes, fast gleißendes Licht.
Wer vom Straßenniveau über die Rampe zum Campus-Gelände hinabsteigt, geht direkt auf den neu errichteten Saal X zu. Inzwischen ist er kein düsterer anthrazitgrauer Klotz mehr wie bei seiner Einweihung; das gesamte Gebäude wurde erweitert und ist nun in heller Sandstein-Optik gehalten. Doch da man leider nicht an ein paar Fenster mehr gedacht hat, ist es dennoch ein in sich geschlossener Quader geblieben.
Auch an der Außenansicht des Zentralgebäudes, der Halle E, hat sich nichts geändert. Nach wie vor hat man die rotbraunen Backstein- und die grauen Betonwände samt der hohen Laderampe gelassen, wie sie waren.
Doch wenn man heute die Halle E durch den Haupteingang betritt, wirkt sie ganz anders als vor drei Jahren bei ihrer Einweihung! Über allem schwebt ein riesiger Stroboskop-Globus an der Decke, der vor Gold und Silber flirrt und die ganze Halle mit seinem Licht flutet. Nach wie vor sind Weiß, Blau und Gold die dominierenden Farben und Elemente, doch die umlaufenden Galerien werden jetzt von gemauerten und reinweiß getünchten Balustraden gestützt, über denen sich royalblau getönte Fensterfronten erheben, wo es vor drei Jahren noch schwarze Stahlgerüste und -geländer gegeben hatte.
Sowohl die Stadtbibliothek zur Rechten als auch die Volkshochschule gegenüber zur Linken nimmt inzwischen drei stattliche Stockwerke ein, wobei es im Campus-Gelände noch einen sechsstöckigen Gebäudeblock gibt, der ebenfalls der VHS vorbehalten ist.
Nur dass die Ausleihe und Rückgabe von Büchern in der neuen Bibliothek heute nur noch elektronisch vonstatten geht, es im Erdgeschoss keine Information und Anmeldung mehr gibt, an der Menschen von Menschen empfangen und bedient werden, und dass man nicht mehr direkt auf die weitläufigen lichten Bibliothekssäle voller Bücherregale blickt, lässt mich die alte Zentralbibliothek immer noch schmerzlich vermissen...
Auch eine Caféteria gibt es wieder. Sie nimmt auf der rechten Seite gut zwei Drittel des Erdgeschosses ein, ist mit Speisen und Getränken gut bestückt und blitzt vor Ordnung und Sauberkeit.
Als ich kurz nach 17:00 Uhr eintraf, stand auf dem Podium an der Stirnseite der Halle E ein Volksmusik-Ensemble, das mir vom "Wolke 8"-Sommerfest von 2023 bekannt vorkam, und brachte neugierigen und willigen Gästen zuerst die Anfänge des Schuhplattelns und danach einen Jodler bei, nicht einen mit dem schlagartigen Wechsel zwischen Brust-, Kehlkopf- und Kopfregister, der für Anfänger kaum zu schaffen ist, sondern einen sanften Andachtsjodler, der gesungen und getönt wird, aber mit Kehlkopfakrobatik nichts zu tun hat.
Zur linken Hand waren bereits die Brandschutztore zur Isarphilharmonie geöffnet, aber noch nicht die Flügeltüren aus schlichtem hellen Holz dahinter. Auch diese zusätzlichen Holztüren vor dem Saal hatte es beim Besuch des "Wolke 8"-Sommerfestes vor zweieinhalb Jahren noch nicht gegeben.
Ich trat auf die Saalordner in Uniform zu, die vor den Toren Wache hielten, und fragte, ab wann man eintreten dürfe."Voraussichtlich ab 18:15", antwortete eine Dame in Uniform. "Aber Sie wissen auch: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!"
"Übrigens" fiel eine Kollegin von ihr ein, "um 18:00 Uhr wird hier im Erdgeschoss die Geburtstagstorte angeschnitten."
Jetzt war es 17:20 Uhr,, so dass mir noch genügend Zeit blieb, um ins Obergeschoss hinauf zu gehen, wo Musiker der Münchner Philharmoniker kleine Soli spielen und für Fragen interessierter Gäste zur Verfügung stehen würden.
Die rau und schmucklos gehaltene, von schwarzen Stahlgeländern gesäumte Betontreppe, der ich nun folgte, schien in meinen Augen eher zu einer Fertigungs- oder Lagerhalle zu führen als zu den Rängen eines Konzertsaals; und in dem schmalen, langgezogenen, ebenso rauen und schmucklosen Korridor wirkten die beiden Musiker, die einander an seinen Enden gegenüber standen, ein wenig einsam und verloren.
Doch mitteilsam waren beide, der hochgewachsene stattliche Herr am Kontrabass am rechten Ende des Ganges wie auch der kleine schmächtige mit seiner Violine am linken; und jeder widmete sich den Neugierigen, die zu ihnen heraufgekommen waren, mit einem freundlichen Lächeln.
Vom Jazz und Swing kenne ich den Kontrabass hauptsächlich als gezupftes Rhythmus-Instrument; doch dieser Musiker der Münchner Philharmoniker strich mit einem Bogen über seine Saiten, so dass er sanft, samten und glutvoll wie ein Cello klang. Als ich den Bassisten fragte, ob es möglich sei, bestimmte Stücke, die dem Cello vorbehalten sind, auch auf dem Kontrabass zu spielen, bejahte er. Auf meine Frage, wer sein Lieblingskomponist sei, nannte er Gustav Mahler. Bei seiner Spielweise und dem Klang seines Instruments hätte ich eher auf Schumann oder Brahms getippt...
Eine andere Zuschauerin fragte ihn nach dem Alter und Wert seines Instruments. Dieser Kontrabass mit seinem dunkel, fast schwarz schimmernden Holz stammte aus dem 18. Jahrhundert und war gut € 250.000,-- wert; ein Eigentum der Münchner Philharmoniker, das gewiss sorgsam gehegt und bewacht wird. Auf meine Frage hin erklärte der Kontrabassist, dass es ähnlich aufwändig und kostspielig ist, sein Instrument zu transportieren wie bei einer Harfe, und obwohl ein Kontrabass nicht so zart und fein gebaut ist wie eine Harfe, verträgt auch sein Korpus und vertragen auch seine Saiten Transporte und Umzüge nicht gut.
Die Violine des Geigers am anderen Ende des Korridors hingegen war erst 40 Jahre alt - sie gehörte ihm seit seinem achten Lebensjahr -, und stammte aus New York. Anders als das Instrument seines Gegenübers ist sie leicht zu tragen und kann überall hin mitgenommen werden.
Doch ganz gleich, wie "jung" oder "alt" es sein mag, teuer und kostbar ist jedes Instrument, das ein Orchestermusiker sein eigen nennt und mit dem er beinahe verwachsen ist, wenn er sein Leben lang als Berufsmusiker spielt und jeden Tag acht Stunden probt bzw. am Abend mit seinem Ensemble auftritt...
Genau in der Mitte des Korridors stand ein Klavier aus schwarzem Ebenholz, an dem um 18:15 Uhr ebenfalls ein Solist spielen und Auskunft geben sollte. Doch ich fürchte, sein Auftritt auf der Galerie der Isarphilharmonie ging ein wenig unter, denn um 18:00 Uhr tönte aus dem Erdgeschoss die Ankündigung über alle Ebenen der Halle hinweg: "Liebe Gäste, es ist soweit: Wir schneiden die Geburtstagstorte an! Wenn Sie sich bitte an der rechten Seite anstellen und dann mit der Torte auf der linken Seite weggehen würden..." Wenn ich mich rechtzeitig für das Münchner Kammerorchester anstellen wollte, um mir einen Platz auf der Bühne der Isarphilharmonie zu sichern, würde mein Zeitfenster für die Torte knapp werden!
Als ich ins Erdgeschoss hinabstieg und an die Schlange zur Rechten aufschloss, reichte der Vorrat an Tellern und Servietten noch, doch Gabeln wurden bereits zur Mangelware. Immerhin rückte die Schlange erstaunlich rasch vorwärts, so dass ich gute Chancen auf mein Gratisstück hatte! Einen Teller und eine Serviette hatte ich bald in der Hand, und dann stand ich auch schon vor der Anrichte.
Im Urzustand hatte die Geburtstagstorte einen Umfang von über einem Quadratmeter eingenommen; doch keine Viertelstunde nach dem offiziellen Anschnitt sah sie aus, als sei ein Termitenheer über sie hergefallen. Gleichwohl balancierte ich nur eine Minute später mein Stück auf dem Teller!
Es war mit Himbeersirup und Puderzucker glasiert und mit einer weißen Wellenlinie aus Zuckerguss versehen, bestand aus drei Schichten Biskuit-Nussboden, und an der bayerischen Creme zwischen den Böden hatte die Konditorei nicht gespart. Kurz, sie sah professionell aus und versprach einen sündhaft-köstlichen Genuss! Leider waren die Gabeln inzwischen endgültig ausgegangen, so dass ich mir mit meiner Serviette zu helfen versuchte.
Das Konditor-Meisterwerk schmeckte ebenso köstlich wie es aussah. Nur: Wer schon einmal versucht hat, eine Cremetorte mit Hilfe einer Serviette zu essen, weiß, wofür und wozu man die Gabel erfunden hat... Immerhin habe ich mir mein Stück einverleibt, ohne auf meinem Beistelltisch oder meiner Kleidung für eine Schweinerei zu sorgen!
Kaum war ich meinen Teller auf der Anrichte der Caféteria losgeworden, war es auch schon Zeit, um sich für das Konzert des Münchner Kammerorchesters anzustellen; und um 18:20 Uhr stießen die Saalordner die Tore auf. Schon zum zweiten Mal marschierte ich mit den anderen Gästen durch das Parkett nach vorne zur Rampe und betrat nach Unterzeichnung des Haftungsausschlusses die Bühne der Isarphilharmonie.
An diesem Abend waren die Stühle für die Gäste nicht neben denen mit den Notenständern und den aufgeschlagenen Partituren platziert, sondern in drei Reihen hinter ihnen. Offenbar war es für die Musikerinnen und Musiker des MKO beim "Wolke 8"-Sommerfest doch ein wenig irritierend gewesen, auf einmal wildfremde Laien direkt neben sich sitzen zu haben, während sie auf ihre Noten und Musikerkollegen achtzugeben hatten...
Wenn es erlaubt wäre, würde ich klassische Musik gern immer auf diese Weise hören: auf dem hell erleuchteten Parkettboden mit seinen kreisrunden Segmenten, die nach den Erfordernissen eines Stückes angehoben oder gesenkt werden können, während ich von meinem Sitz aus die Bögen der Streicher über den Steg ihrer Instrumente eilen sehe und der Holzboden unter mir unter den Schallwellen der Töne leise vibriert. In Momenten wie diesen möchte ich nichts als dasitzen und mich in den Wohlklang der Streicher hüllen wie in ein weiches kostbares Tuch...
Leider ist der Zuschauerraum einschließlich der Ränge und der Decke unverändert kohlrabenschwarz, so dass ich immer noch an Kreuz, Gruft und Grabesluft denken muss, wenn ich den Blick zufällig einmal von den Instrumenten wende und nach oben und in die Runde richte...
Der Abend mit dem MKO begann mit der 1. Symphonie in C-Dur von Carl Philipp Emanuel Bach, nach Friedemann der zweite begabte Musikersohn von Johann Sebastian Bach, der von Leipzig nach Hamburg wechselte und dort sowohl die Stücke seines Vaters als auch seine eigenen mit Erfolg aufführte.
C.P.E. Bach hat durchaus seinen eigenen Stil; frischer, anmutiger und zugleich gefühlvoller als der seines berühmten Vaters, dessen Kompositionen - vor allem seiner geistlichen Musik - nach meinem Empfinden etwas Herbes und Strenges innewohnt, das der klaren, unerbittlichen Logik seiner Harmonielehre folgt. Bei J.S. Bachs Sohn kann man die Figuren, Verneigungen und Compliments des Rokoko förmlich sehen, während er zugleich auf deutliche Kontraste in der Dynamik und den Wechsel zwischen rasch dahineilenden und bedächtig atmenden Passagen setzt.
Es hilft, den Melodiebögen genauer zu folgen, wenn ein Experte wie Ulrich Habersetzer von BR Klassik die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf bestimmte Tempiwechsel, Einsätze und Dialoge der Streichergruppen lenkt und besondere Feinheiten der Komposition hervorhebt.
Auch - zumindest mir -, wenn ein junger Dirigent wie Xandi van Dijk sichtlich für die Musik und die Stücke brennt, die sein Orchester spielt, und die Gewohnheit hat, jede musikalische Phrase mit den Bewegungen seines ganzen Körpers und leisem, aber deutlich hörbarem Raunen und Flüstern wiederzugeben. Hat Xandi van Dijk seine Technik von Sir Simon Rattle übernommen? War er irgendwann bei ihm in einem Meisterkurs gewesen?
Nach dem Ausflug in die Generalbasszeit stand auch an diesem Abend ein modernes Stück eines lebenden zeitgenössischen Komponisten auf dem Programm, "Wald" von Enno Poppe. Einfach nur ein Wald? Wohl eher der verbotene Wald von Hogwarts in der Walpurgisnacht oder in den Rauhnächten!
Da waren Gnome, Kobolde und Trolle, die brummend und grummelnd durch das Unterholz polterten; Hexen, die Tränke brauten und über dem Kessel tuschelnd und kichernd ihre Zaubersprüche raunten; mittendrin das Gejaule und Geschrei zweier liebestoller Kater, die einander im Streit um eine Favoritin in die Wolle gerieten; und zwischendurch das Jammern und Wimmern unerlöster Seelen... Kurz, ein Wald, dessen Lauten man in einem Konzertsaal aufmerksam und gespannt lauscht, in dem man aber nicht um Mitternacht oder in der frühen Dämmerung unterwegs sein möchte!
Doch dann war die Zeit auf der Bühne der Isarphilharmonie leider auch schon wieder zu Ende.
Es stand der letzte Programmpunkt dieses Abends an; der Versuch, Musik, Literatur und darstellende Kunst zu einem Gesamtkunstwerk zu verschmelzen, der im Saal X stattfinden sollte. Ich war gespannt, auf welche Weise dies vonstatten gehen würde; denn genau jene drei Elemente - die Welt der Klänge, des Wortes und der bildhaften Darstellung - haben in meinem Bewusstsein und meiner Vorstellungswelt seit jeher zusammengehört.
Also verließ ich die Halle E, überquerte den Campus und hielt auf die sandsteinfarbene Front des Saales X zu. Wie ich es bereits bei seiner Einweihung für richtig gehalten hatte, waren heute im Parkett gepolsterte Stühle dicht aneinandergereiht, damit das Publikum nicht nur Rock- und Pop-Konzerte, sondern auch Vorträge und Stücke anhören konnte, die Stille und Konzentration erforderten. Die schlichten schwarzen Wände und der kompakte, in sich geschlossene Raum erinnern mich stark an die Black Box im alten Gasteig; und wie dort gibt es auch an der Stirnseite des Saales X eine erhöhte, erstaunlich geräumige, im Gegensatz zum Zuschauerraum hell erleuchtete Bühne.
Über der Bühne war das Motto und der Inhalt der Vorstellung an die Wand projiziert: "Über Tyrannei - Zwanzig Lektionen für den Widerstand", ein Graphic Novel, dessen Worte und Texte Timothy Snyder verfasst und Nora Krug in Zeichnungen umgesetzt hat. In diesem Graphic Novel geht es um den Widerstand, den Menschen gegen die NS-Diktatur geleistet haben, und auch um die Regeln bzw. Verhaltensweisen, mit deren Hilfe man gegen ein totalitäres Regime oder System Widerstand leisten kann. Während Bilder an die Wand projiziert wurden, sollte jemand Passagen aus diesem Werk vorlesen und danach ein Streichquartett das Gelesene ins Gemüt sinken lassen.
Da die zwanzig Lektionen - eher Leitsätze - für den Widerstand vor Beginn der Veranstaltung ebenfalls an der Wand zu lesen standen, nahm ich an, dass die Vorleserin auf diese zwanzig Punkte nach und nach eingehen würde; und auch, dass Vortrag, Bild und Musik zu einer fließenden Collage verschmelzen würden, die Verstand, Gemüt und Sinne gemeinsam ansprachen und mitnahmen.
Doch leider kam es anders. Die Zeichnungen, die im Lauf der Veranstaltung über der Bühne erschienen, erschienen mir so nüchtern und trocken wie die Graphiken und Leitsätze, die ein Overhead-Projektor in der Schule oder in einem Workshop an die Wand warf.
Es wurde kaum von Episoden aus dem Widerstand gegen das NS-Regime erzählt und auf keine der angekündigten zwanzig Lektionen eingegangen. Nur aus dem Prolog und Epilog trug die Vorleserin einige Passagen vor: zum einen, wie wichtig es ist, sich ein Bewusstsein für Geschichte zu bewahren, und dass Geschichte nicht vergessen und abgetan werden darf, wenn sich die Fehler vergangener Generationen nicht wiederholen sollen; und zum anderen, dass es gilt, sich der Sprache und Rhetorik von Diktatoren bewusst zu widersetzen.
Und zwischen den gelesenen Textpassagen spielte das Streichquartett ausnahmslos Stücke, die von bleischwerem Gram erfüllt waren.
Trocken-moralisierende Abhandlungen und brütende Trauermusik sind nicht gerade etwas, das Gemüt und Sinne anspricht und mitnimmt; sie wirken wie die gewichtige Rede des Rektors einer Schule bei einer offiziellen Feier in der Aula, der man sich nicht entziehen kann und die man über sich ergehen lässt. Ich kann es jenen, die sich im Zuge der Veranstaltung erhoben und den Saal verließen - und es waren ihrer einige -, nicht verdenken und wäre vielleicht auch gegangen, wenn die Worte und ihr Sinn nicht richtig und wichtig gewesen wären.
Die gesamte Veranstaltung setzte meinem Gemüt und auch dem anderer Zuschauer einen Dämpfer auf, so dass wir, als sie zu Ende ging, den Saal X in stiller, beklommen-bedrückter Stimmung verließen.
Hiermit endete auch der offizielle Teil der Jubiläumsfeier "40 Jahre Gasteig". In der Halle E hätte es jetzt noch anderthalb Stunden Musik von einem DJ gegeben, aber danach war mir nicht zu Mute; also verließ ich das Gelände und ging zur U-Bahn-Station Brudermühlstraße, um nach Hause zu fahren.
Bis zu diesem Gesamtkunstwerk im Saal X war der Abend für mich eine kurzweilige, anregende und auch lehrreiche Zeit gewesen, die ich genossen und gerne mitgenommen habe.
Doch muss es sein, dass man Menschen, die eine Feier besuchen und sie genießen, einen Abend lang ihre Sorgen und Nöte hinter sich lassen wollen, mit Moralpredigten Gesinnung beibringt und sie mit beschwertem Sinn und Gemüt in die Nacht entlässt?