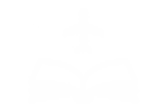Eine kleine Gedenkminute für eine echte Münchner Institution
Obwohl das Neue Rathaus am Marienplatz mit seinen 158 Jahren – es wurde von 1865 bis 1909 von dem begnadeten Architekten Georg von Hauberrisser und seinem Bauteam errichtet – im Vergleich zu den Rathäusern von Augsburg, Nürnberg, Frankfurt oder Lübeck ein relativ „junges“ Rathaus ist, wäre der Marienplatz ohne jene feinziselierte neugotische Fassade mit ihrem hoch aufragenden Spitzturm in der Mitte, der das weltberühmte Glockenspiel birgt, und auf dessen Balkon das Münchner Kindl jedes Jahr zu Beginn der Adventszeit die Stadt segnet und der Oberbürgermeister die Fußballspieler des FC Bayern München empfängt, wenn sie die Champions League oder Europameisterschaft gewonnen haben und den Pokal nach Hause mitbringen, ganz einfach nicht der Marienplatz.
Ich denke, ich gehe nicht zu weit in der Einschätzung, dass mir einheimische Münchnerinnen und Münchner, unzählige „Zuagroaste“ (Eingewanderte für Nicht-Bayern) und viele Besucherinnen und Besucher in diesem Punkt ohne zu zögern zustimmen würden.
Und direkt unter dem Neuen Rathaus erstreckt sich das gewaltige Gewölbe, das seit 1874 – also bereits seit 149 Jahren – unter seiner ausgeklügelten Dachkonstruktion mit ihren halben Kuppeln und gotischen Spitzen den Ratskeller barg.
Barg? Ja, denn Architekten und Restauratoren haben festgestellt, dass sowohl das Neue Rathaus als auch das Kellergewölbe, das sein immenses Gewicht trägt und abfängt, gründlich saniert und restauriert werden muss, wenn es auf Dauer fortbestehen soll. Und dies hatte zur Folge, dass mit dem Neuen Rathaus auch der Ratskeller am Ende des Jahres 2025 nach 149 Jahren Dienstzeit schließen und das Gewölbe räumen musste.
Obwohl der Grund für die Räumung des Rathauses und des Ratskellers naheliegend und vernünftig ist, konnten und wollten die einheimischen Münchnerinnen und Münchner sowie langjährige Einwohner und auch gerne anreisende Besucherinnen und Besucher nicht so recht glauben, dass es sein musste.
Meine Ex-Kollegin und ich, die wie alle anderen gebildeten und informierten Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt davon erfuhren, wollten in der Adventszeit noch einmal in den Ratskeller essen gehen und uns von dem riesigen, verschachtelten Gewölbe mit seinen unzähligen Winkeln, Nischen und chambres séparées, seiner ausnahmslos hervorragenden bayerisch-gutbürgerlichen Küche und seinen immer freundlichen Kellnern verabschieden.
Keine Chance! Ab dem ersten Adventswochenende war der Ratskeller restlos ausgebucht!
Keine gute Idee war der Vorschlag der Grünen im Rathaus, in diesem Gewölbe einen modisch-schicken Partykeller mit „Bällebad“ einzurichten.
Ich bitte zu bedenken, dass der Ratskeller keine x-beliebige Gaststätte unter vielen und auch keine billige Kneipe ist, sondern das erste Restaurant in München und eine echte Institution, die über Jahrzehnte hinweg Millionen an Gästen besucht und die Winkel, Nischen und chambres séparées gefüllt haben!
Aus meiner Sicht und auch aus der meiner Ex-Kollegin muss der Ratskeller als erste Adresse und echte Institution Münchens ebenso erhalten bleiben wie das Neue Rathaus mit seiner neugotischen Fassade und seinem nicht weniger fein gestalteten Innenhof, in dem man/frau im Sommer so lauschig und gemütlich sitzt.
Als im Jahr 2020 die weltberühmte Kathedrale Notre Dame de Paris brannte – inzwischen ist sie dank des unermüdlichen Einsatzes des Architekten- und Restauratorenteams soweit hergestellt, dass man sie wieder betreten kann –, hat dieses Ereignis seinerzeit die ganze Stadt mobil gemacht.
Denn auch wenn es recht wenige Dinge gibt, die den sehr weltlich gesinnten Bürgerinnen und Bürgern von Paris heilig sind: Notre Dame ist es. Sie bildet den Mittelpunkt ihrer Stadt und gehört genauso zur Seine-Metropole wie der Eiffelturm und der Invalidendom, wie der Place de l’Etoile mit dem Arc de Triomphe, wie der Louvre und die Brücken über die Seine. Und dies um ein paar Jahrhunderte länger als alle anderen Wahrzeichen.
Und so kamen seinerzeit im Jahr 2020 Pariserinnen und Pariser und postierten sich Tag und Nacht als Mahnwache rund um die mächtige Kathedrale, um sie buchstäblich mit Leib und Leben gegen jedes weitere Unheil zu beschützen. Und welch ein Aufatmen ging durch die Menge, als das Expertenteam erklärte, dass beide Türme samt dem Bauwerk als Ganzes gerettet werden konnten und erhalten bleiben würden!
Hm. Wenn jetzt, im Jahr 2026, die Bau- und Restaurationsarbeiten am Neuen Rathaus und seinem Gewölbe beginnen, empfiehlt es sich vielleicht, dass wir ein wachsames Auge darauf haben, was am Marienplatz vor sich geht. Auch wenn es aus meiner Sicht nicht notwendig ist, dass wir das Neue Rathaus umstellen, sollten wir das für Münchner und Bayern leider oft typische Phlegma überwinden und für seinen Erhalt und auch den seines Gewölbes einschließlich des Ratskellers einstehen!