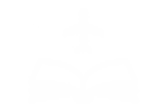Vom Zauber alter Landgasthöfe
Gegenüber den Köstlichkeiten aus dem Nahen und Fernen Osten, die seit gut fünfzehn Jahren unsere Städte geradezu überrannt haben und inzwischen das Bild der Fußgängerzonen und Einkaufszentren prägen, möchte ich auch den Schätzen und Köstlichkeiten der gutbürgerlichen Küche ein Denkmal setzen.
Denn die bayerische Form der Gastlichkeit vor allem in Gestalt der altehrwürdigen Landgasthöfe, von denen es jahrzehntelang in jedem Dorf eine gab, ist durch die Dominanz der Küche aus dem Nahen und Fernen Osten und auch durch das Rentenalter der Wirtspaare eine vom Aussterben bedrohte Gattung, es sei denn, dass sich ihre Kinder dafür entscheiden, das Erbe ihrer Eltern fortzuführen. Und so erscheint es mir als recht und billig, im Rahmen eines Abschieds an zwei solche Landgasthöfe zu erinnern.
Eine langjährige Bekannte von mir, die in Nymphenburg (im gleichnamigen Stadtteil, nicht etwa im Schloss oder Park) geboren und aufgewachsen ist, war fünfundvierzig Jahre lang zwischen dem Pilsen- und dem Wörthsee zu Hause. Nach dem Tod ihres Mannes, mit dem sie in vorgerücktem Alter noch ein spätes und großes Eheglück erlebt hat, ist sie auf die Empfehlung und Vermittlung ihres Sohnes und ihrer Schwiegertochter hin in einen kleinen Ort bei Bregenz umgezogen, sprich an das österreichische Ufer des Bodensees, um fortan in ihrer Nähe zu leben, hat aber ihren früheren Heimatkreis nicht völlig aufgegeben und sozusagen dort noch einen Koffer stehen.
Bevor sie ihre vertraute Heimat verließ, hat sie mich eingeladen, mit ihr zwei Gaststätten zu besuchen, die sie seit vielen Jahren kennt; und so ergab es sich, dass unser Zusammentreffen von ihrer Trauer um ihren Mann und vom Abschiednehmen in jeder Hinsicht geprägt war, aber auch vom bewussten Genießen eines gediegenen Ambientes und eines hohen gastronomischen Niveaus; von dem ich nachfolgend ein wenig erzählen möchte.
Der Bernhardhof / Gasthof Erlinger in Andechs
Von Seefeld, einem Dorf zu Füßen des gleichnamigen Schlosses und Stammsitzes der Grafen von Toerring, zum Ort und Kloster Andechs sind es gerade einmal zehn Fahrminuten über die rollenden Hügel und grünen Wiesen des Fünf-Seen-Landes hinweg, das sich zwischen dem Ammersee und dem Starnberger See erstreckt; und genau dazwischen liegen der Wörthsee, der Pilsensee, an dem meine Bekannte fünfundvierzig Jahre lang gelebt hat, und der Echinger See.
Diesen fünf Seen verdankt die oben genannte Region ihren Namen, mit dem sie seit dreißig Jahren so emsig und erfolgreich um Besucher wirbt, dass manch einem Einheimischen der Strom der Tagestouristen vor allem an den Wochenenden zuviel wird.
Eine deutlich ansteigende Landstraße führ von Seefeld direkt in den Ort Andechs, ein Dorf, über dem sich eine kleine aber steile Anhöhe erhebt, gekrönt von den imposanten Zwiebeltürmen des Klosters Andechs, zu dem man nur zu Fuß hinauf pilgern darf.
Obwohl Kloster Andechs selbst ein Flair und ein gastronomisches Angebot bietet, das weit über das Fünf-Seen-Land hinaus bekannt und berühmt ist, findet man schon im Ortszentrum einige ansehnliche Gaststätten von gutem Ruf; und einer davon ist der Bernhardhof mit seinen weißgetünchten Mauern und dem altersschwarzen Gebälk seines mächtigen Dachstuhls.
In einer Zeit, die von gefühlt abertausend fernöstlichen, türkischen, griechischen oder italienischen Restaurants geprägt ist, genießt der Anblick, den der Bernhardhof seinen Gästen bietet, fast schon Seltenheitswert:
Hohe, mächtige Gewölbe aus dickem Mauerwerk, das im Sommer für Kühle sorgt und im Winter die Wärme des gemauerten Kamins in der Gaststube hält; aus gedrechseltem Holz gefertigte Sitzgruppen und -bänke, die von Meistern ihres Fachs für die Ewigkeit gefertigt wurden, die mit üppigen Polstern im Biedermeierstil bedeckt sind; edles Porzellan, Pokale und Urkunden auf den Fensterbänken und dem umlaufenden Kaminsims, die von den hervorragenden gastronomischen Leistungen sprechen, derer sich die Wirtsfamilie Erlinger rühmt.
So ist Großmutter Rosi für ihre selbstgebackenen Kuchen und Torten berühmt, von denen viele Gäste sagen, sie seien die besten im ganzen Fünf-Seen-Land. Um die Probe aufs Exempel zu machen, hat meine Bekannte eine Erdbeer-Rhabarber-Schichttorte probiert, ich eine mit Bananen und Nuss-Schoko-Creme. In der Tat mundeten beide Torten hervorragend, ebenso wie der liebevoll von Hand gefilterte Kaffee, den wir dazu serviert bekamen.
Das Wirtspaar Erlinger kümmert sich um die Verwaltung des Anwesens und - gemeinsam mit den freundlichen und flinken Bedienungen in Tracht - um das Wohl ihrer Hotel- und Tagesgäste.
Und der Stammhalter der Familie hat nach seiner Ausbildung die Küche übernommen. Zwar ist die Auswahl der Gerichte auf der Speisekarte begrenzt; doch zum einen bereitet der Chefkoch mit seinem Team jedes gewählte Gericht frisch zu, und zum anderen kündet eine ganze Serie an Michelin- und Gourmet-Sternen von dem hohen Niveau, auf dem dieser gerade einmal fünfundzwanzig Jahre junge Mann jetzt schon unterwegs ist.
Bemerkenswert finde ich neben den von Hand mit Sorgfalt zubereiteten und voller Stolz servierten Gerichten und Backwaren die einzigartige Atmosphäre, die alte Landgasthöfe wie der Bernhardhof verströmen:
Zum einen atmet das gediegene Mobiliar und Dekor Stil, ohne zu streng oder zu plüschig zu wirken; zum anderen herrscht selbst bei lebhaftem Kommen und Gehen der Gäste eine Ruhe und Stille, die über die Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hinweg in dem alten Mauerwerk hängengeblieben ist.
Wie schon vorher erwähnt, genießen Häuser dieser Art in unserer auf rasche und systematische Abfertigung ausgerichteten Zeit fast schon Seltenheitswert. Hier im Bernhardhof, bei der Wirtsfamilie Erlinger, sieht, spürt und schmeckt man, dass jeder Gast als Mensch wahrgenommen wird und zählt!
Der Gasthof Dietrich in Auing am Wörthsee
Nach einem kleinen Umtrunk und ausgiebigem Schwelgen in Erinnerungen in der ebenso stilvoll wie gemütlich eingerichteten Wohnung meiner Bekannten schlug sie für das Abendessen den Gasthof Dietrich in Auing am Wörthsee vor.
Da ich ihn ebensowenig kannte wie vor diesem Nachmittag den Bernhardhof in Andechs, aber dem Urteil meiner Bekannten, die selbst eine ausgezeichnete und vielseitige Köchin ist, jederzeit vertrauen kann, stimmte ich ihrem Vorschlag zu.
Von Seefeld und dem Pilsensee liegt der Wörthsee nur einen weiteren Katzensprung entfernt. Wieder führt die Straße über rollende Hügel und durch saftige grüne Wiesen, von denen man an Föhntagen bis zum Ettaler Manndl und zur Benediktenwand hinüber blicken kann.
Rund um den Wörthsee findet man u.a. den großen Augustiner-Biergarten und kleine stille Dörfer wie Steinebach und Auing; und in Auing kennt meine Bekannte seit Jahrzehnten den Gasthof Dietrich, den vor einigen Jahren ein junges Wirtspaar aus Kroatien übernommen hat.
Beim Gasthof Dietrich sind die Mauern nicht ganz so dick wie beim Bernhardhof in Andechs, und er ist niedriger und gedrungener gebaut; doch auch dieses Abendrestaurant ist in einem alten Gebäude untergebracht. Sein Stil und seine Bauweise deuten auf das frühe 20. Jahrhundert hin. Auch die Gaststube ist deutlich niedriger und die Polster auf den Sitzgruppen sind schlichter als bei der Wirtsfamilie Erlinger in Andechs; aber dafür bestehen sowohl das Dachgebälk als auch die Verschalung der Innenräume samt allen Möbeln durchgängig aus hellem glattem Kiefernholz.
Und ganz gleich, ob Schnitzel, Braten, gegrillter Fisch oder Steak aus der Region, der Gasthof Dietrich bietet für jeden Geschmack etwas, auch - wie meine Bekannte mir verriet - Salate für Vegetarier und Veganer. Doch bei dem jungen Wirtspaar aus Kroatien liegt der Schwerpunkt eindeutig auf den Klassikern der Balkanküche:
čevapčiči (Grillwürstchen aus frischem Hackfleisch), rajzniči (Spieße aus kurz gegrilltem Fleisch) und pliesniči (Hackbraten mit Käsefüllung), stets mit frischem Salat als Beilage und je nach Wahl mit Djuvecreis oder Pommes frites serviert.
Meine Bekannte wählte an diesem Abend "halb und halb", sprich, čevapčiči und einen Fleischspieß mit Djuvec-Reis; und wie sie mir versicherte, war beides von ausgezeichneter Qualität.
Da Gaststätten im Raum München und Oberbayern heute nur noch selten Innereien anbieten, weil man sie entweder heiß und innig liebt (wie ich) oder vor ihnen voller Abscheu zurückprallt (wie viele Menschen), wählte ich gebratene Leber mit gegrillten Ananas-Scheiben und Pommes frites und war gespannt, was bei meiner Wahl herauskommen würde.
Die Leber, die ich im Gasthof Dietrich serviert bekam, hätte nicht besser zubereitet sein können: butterweich und saftig und keine Spur von Trockenheit oder Bitterkeit, wie es bei gebratener Leber gelegentlich vorkommt. Die Pommes frites kommen spür- und schmeckbar direkt aus der Fritteuse und sind mit frischem Bratfett zubereitet; und die gegrillten Ananas-Scheiben sorgen für einen kleinen besonderen Gaumenkitzel zum Abschluss der Mahlzeit (zumindest bei mir).
Grundsätzlich sind die Portionen, die man serviert bekommt, reichlich und großzügig bemessen, so dass es nicht alle Gäste schaffen, ihren Teller leer zu essen; doch in diesem Fall bietet der Gasthof Dietrich, wie es in Landgasthöfen nicht selten vorkommt, Papiertüten zum Mitnehmen an.
Doch an diesem Abend haben wir beide unsere gute und reichliche Mahlzeit bis auf den letzten Bissen verputzt und gingen nach einem letzten Slivovič (sie) bzw. Espresso (ich) hochzufrieden und - trotz des bevorstehenden Abschiedes meiner Bekannten von ihrer vertrauten Heimat - in ruhiger Harmonie nach Hause.