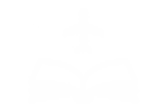I. Teachers on Stage
Der erste dieser Konzertabende, Teachers on Stage, fand im erst vor kurzem neu eingerichteten Konzertsaal der Musikschule statt. Im Vorfeld hatte es keine große Ankündigung gegeben, nur auf der Website der Schule und in Gestalt einiger kleiner Plakate an den Hauptverkehrsadern von Neuried und Fürstenried West, sprich an der Forstenrieder, Münchner und Graubündner Straße.
Als ich den ebenso schlichten wie hellen Konzertsaal im Erdgeschoss betrat, erschien mir die Bühne, auf der zwei Harfen, ein Flügel und zwei Blockflöten aufgebaut waren, größer und geräumiger als der Zuschauerraum, auch weil der Bereich unmittelbar rund um das Podium ebenso wie der Durchgang vom Saal zu den hinteren Schul- und Übungsräumen gemäß den Vorschriften des Brandschutzes als Fluchtweg frei bleiben musste. Alles in allem gab es fünf Stuhlreihen à 20 Stühle an der Stirnseite und drei an der rechten Querseite des Saals, d.h. für maximal 160 Personen. Hinzu kamen vorne rechts sechs "Notstühle" für die Kinder einiger Mitwirkender und im Foyer hinter den großen gläsernen Flügeltüren noch 20 weitere Sitzgelegenheiten, die aus den Unterrichts- und Übungsräumen zusammengetragen und für das Publikum bereitgestellt wurden.
Denn der Ankündigung waren an diesem Abend viel mehr Zuschauerinnen und Zuschauer gefolgt, als die Veranstalter erwartet hatten, so dass der Saal schließlich brechend voll war und sich in Windeseile von selbst aufheizte, als um 19:00 Uhr das Konzert begann.
Neben einer der beiden Rektorinnen, die Klavierunterricht gibt, bieten sieben Lehrerinnen und sechs Lehrer für Kinder und Jugendliche von vier bis achtzehn Jahren Unterricht in Gesang, Blockflöte, Geige, Cello, Kontrabass, Harfe, Trompete, Posaune, Saxophon, Akkordeon und E-Gitarre sowie klassischer Konzertgitarre.
Und die Lehrkräfte, die an diesem Abend außer ihren Instrumenten und Notenständern auch Stühle und Hocker schleppten, führten durch ein buntes Programm quer durch die Jahrhunderte, Genres und Stile.
Jacob van Eyck, "Bravade" für Blockflöte
Zwar wies die Flötistin in ihrer kurzen Einführung darauf hin, dass ihr Instrument aus der Barockzeit stammte, ihre Form und Beschaffenheit wie auch ihr Klang glich indes durchaus der uns vertrauten Blockflöte.
Auch die Barockflöte heult wie ein Wintersturm im Schornstein, wenn der Luftstrom beim Blasen ins Mundstück nicht stetig und gleichmäßig dosiert ist, und tönt klar und rein, wenn das Lampenfieber nachlässt und der Atem ruhig und kontrolliert fließt.
Ab der Hälfte und gegen Ende des Stückes spielte die Flötistin sowohl mit halsbrecherischer Rasanz als auch lupenrein und bewies eindrucksvoll, dass eine Blockflöte nicht nur ein Instrument für Kinder ist, sondern auch virtuos klingen kann.
Henry Purcell "Two on One Upon Ground" und "Tollets Ground" für Blockflöte, Violine und Harfe
Während das erste der beiden Trios sanft, verträumt und leicht melancholisch herüberkam, war das zweite ein lebhafter Tanz von schwereloser Leichtigkeit. Zwei Stücke, die den besonderen Klang dieser drei Instrumente und die Harmonie zwischen ihnen klar und deutlich zum Vorschein brachten.
Der Klang von Harfe, Geige und Flöte führt in eine ferne, lange zurückliegende Zeit zurück, vermag uns indes immer noch genauso zum Träumen zu bringen oder in eine leichte, heitere Stimmung zu versetzen wie vor über 350 Jahren, als der britische Komponist Henry Purcell diese beiden Stücke schrieb.
Denn die Regeln und Gesetze der Komposition, sprich, die Tonarten und Tonleitern im Quintenzirkel, die Harmonieschemata sowie die musikalischen Phrasen und Figuren, auf denen die Musik Europas aufgebaut ist, wurden vor über 350 Jahren von Johann Sebastian Bach und Heinrich Schütz in Deutschland, Claudio Monteverdi und Antonio Vivaldi in Italien, Georg Friedrich Händel und Henry Purcell in Großbritannien und vielen anderen Komponisten der Generalbasszeit erschaffen, gelten heute nach wie vor und prägen seither unser musikalisches Gehör.
Christophe Yunes - "Wintertag" und "Weiße Rose in der Dämmerung" für Gesang und Klavier
Diese klassisch gesetzten Kunstlieder beruhen auf zwei Gedichten von Hermann Hesse. Während "Wintertag" von einer erblühenden Hoffnung auf den Sommer und die Liebe spricht, die sich jetzt im Winter noch nicht erfüllen wird, handelt "Weiße Rose in der Dämmerung" vom Dahinsiechen und Sterben eines Menschen, der einem anderen wertvoll und kostbar ist.
"Wintertag" ist von Hoffnung und Warten und "Weiße Rose in der Dämmerung" von Melancholie und Schmerz erfüllt, doch in ihrem Gesamtcharakter wie auch im Vortrag der Sängerin und des Pianisten erschienen mir beide Lieder als knapp daneben gegriffen.
Tief empfundene Gefühle und Seelenzustände ziehen sich durch Hesses gesamtes literarisches Schaffen, doch sowohl der Gesang als auch die Klavierbegleitung, die den Gehalt seiner Gedichte tragen und transportieren sollte, kam für meine Begriffe zu weich und süßlich herüber und verlieh dadurch beiden Liedern etwas Unechtes und Geziertes.
Doch was man auch immer von Hesses Lyrik und Prosa halten mag, weich oder gar süßlich klingt sie für mein Empfinden nie, vor allem weder unecht noch gar geziert. Es sind tiefgehende Gefühle und Seelenzustände, die Hermann Hesse zum Ausdruck bringt; und die Kraft und Würde seines Stils liegt für mich darin, dass es ihm mit diesen Gefühlen und Seelenzuständen ernst war.
Denn sein Leben lang war und blieb er ein Suchender und Ringender nach dem richtigen, vor allem aufrichtigen Weg des menschlichen Geistes und Gemütes, und auf dem dornigen, mühsamen Weg, den er einschlug, hat er tief und schwer gelitten.
Und Hesses ernst gemeinte Suche und das Ringen um den richtigen Weg ist es, was erfasst und transportiert werden muss, wenn man seine Werke glaubwürdig herüberbringen will.
Johannes Brahms, "Sonate für Klavier und Violoncello in e-moll", 1. Satz, Allegro non troppo
In dieser Sonate, vor allem im Cellopart, war dagegen ganz und gar nichts Weichliches und Süßliches oder gar Unechtes und Geziertes zu spüren.
Meine Güte, wie Brahms ein Cello zum Singen, Erglühen und Klagen bringen kann! Neben seinem musikalischen Leitstern Robert Schumann und Antonín Dvorak ist Brahms wie kaum ein anderer Komponist fähig, die Klangfacetten zu entfalten, die das Cello in sich birgt:
Morgennebel über einem stillen Wiesengrund oder Waldsee, das tiefe glühende Rot des westlichen Abendhimmels, den Duft und Geschmack eines schweren herben Rotweins und den wirbelnden Tanz von Herbstlaub im Wind.
Für meine Begriffe klingt im ersten Satz der "Sonate in e-moll" durch, was Brahms von seinem Vorbild Robert Schumann gelernt hat, und auch seine treu und tief ergebene Verehrung für Clara Schumann. die ihm als ebenso klar und beständig strahlender wie unerreichbarer Stern vor Augen stand wie die Venus am Morgen- und Abendhimmel.
Manuel Ponce, "Sonatina Meridional" für Konzertgitarre, 1. Satz "Campo"
Auf die erdenschwere Tiefe und Kraft und die samtige, dunkel lodernde Glut des Cellos folgte die filigran schwebende Zartheit und Leichtigkeit und der helle aber milde Schimmer der Konzertgitarre.
In seiner Auftragsarbeit sollte Manuel Ponce seinerzeit die Atmosphäre einer Landschaft in Spanien zum Ausdruck bringen. Der Gitarrenlehrer Henrique de Miranda Reboucas, der aus dem Norden Brasiliens stammt, meinte, für ihn und seine Landsleute und auch für andere Lateinamerikaner würde die "Sonatina Meridional" recht nordisch klingen, in etwa so, wie ein Nordeuropäer sich Spanien vorstellt.
Ich gebe zu, dass ich als Mitteleuropäerin weder ein Gespür noch eine Vorstellung habe, wie ein musikalisches Werk, das Spanien verkörpern soll, für einen Lateinamerikaner hätte klingen müssen.
Denn als Henrique de Miranda Reboucas zu spielen begann, klang für mich seine Konzertgitarre so licht und heiter und so mild und ruhevoll, wie ich mir den Himmel über Spanien und das Land vorstelle, das sich unter ihm erstreckt. Hauptsächlich musste ich bei diesem Satz der Sonate an den Hang eines Weinbergs denken und an blaue und weiße Trauben, die im Licht der Sonne glänzen und reifen...
Vor allem zeigte dieser Lehrer eindrucksvoll, was für ein feines und nuancenreiches Instrument die klassische Konzertgitarre sein kann. Richtig gezupft bietet sie zehnmal mehr als "Schrumm-Schrumm" am Lagerfeuer oder Begleitakkorde zu einem Pop-Song, kann schwerelos tanzen und schweben und klingt in jeder Lage und Tonart sanft, warm und weich.
Astor Piazzolla - "Nightclub 1960" für Harfe und Violine
Es ist für mich immer wieder erstaunlich, was Tango in seinem Ursprungsland Argentinien ist und was wir Mitteleuropäer daraus gemacht haben! Wie sind Tanzpaare in Deutschland, Österreich etc. auf die Idee gekommen, Tango müsse stark akzentuiert und vor allem eckig und roh im Ausdruck sein?
Stattdessen erschufen zwei Damen - eine an der Konzertharfe, die andere auf ihrer Geige - ein höchst subtiles, stilles und vor allem sanftes Tongemälde:
Eine verschwiegene Bar in einer lauen Sommernacht irgendwo in Buenos Aires, deren Fenster weit geöffnet sind, so dass der Raum von blauen Schatten und den Silberstrahlen des Mondlichts erfüllt ist. Von draußen weht dann und wann mit einer leichten Brise der Duft von Rosen und Jacaranda-Blüten herein, süß und betörend.
Am Tresen sitzen oder lehnen die Gäste bei ihrem Drink, unterhalten sich leise und gedämpft oder vertiefen sich im Spiegel ihres Glases in ihre Gedanken und Träume.
Übewr dem Raum schwebt der Klang der Harfe, sanft, leicht und schwerelos perlend, während sich die Geige elastisch und geschmeidig schlängelt und windet, sich an den Tönen der Harfe emporrankt wie eine Trichterwinde, in deren samtvioletten Blüten sich diese Sommernacht widerspiegelt.
Robert Merdzo, "No. 437, 572 und 502"
Dieser E-Gitarrist war für mich die Entdeckung dieses Abends! Denn obwohl seine Kompositionen nur Nummern und keine Namen tragen, zeigte er, zu welch feinen Nuancen und Facetten eine E-Gitarre fähig ist, wenn ein Meister sie spielt.
Meine geneigten Leserinnen und Leser mögen mir glauben oder nicht, aber diese Mischung aus Jazz, Blues und Rock, die Robert Merdzo spielt, habe ich in vergleichbarer Weise bisher nur von David Gilmour von Pink Floyd gehört.
Merdzos Leadgitarre kann einmal so schlicht und sanft klingen wie die Begleitung zu "Wish You Were Here", um sich dann in den Äther empor zu schwingen und hoch und weit ins Weltall hinaus zu tönen wie in "Shine On You Crazy Diamond", nur um einiges schlichter und bescheidener, weit weniger sphärisch und monumental, als man es von Gilmours mal klagender, mal schwelgender, aber stets überwältigender E-Gitarre kennt.
Dann wieder ist Merdzo zu rasanten und komplexen Läufen fähig, mit denen er Geschichten zu erzählen vermag, ähnlich wie es einst Steve Hackett in den frühen Jahren von Genesis konnte...
Ohne Zweifel habe ich an diesem Abend einen absoluten Könner an der E-Gitarre erlebt, nur still, bescheiden und unauffällig.
"Escuelo" von Astor Piazzolla
Zwei Geigen, drei Celli, ein Kontrabass und ein Akkordeon entführen diesmal in ein ganz anderes Lokal: eine obskure Kneipe, in der sich eine Gruppe Geheimagenten in Nadelstreif-Anzügen und Fedorahüten versammelt hat und die Jagd auf ihr Opfer geplant hat: ein "Maulwurf", ein Verräter in den eigenen Reihen.
Dieser Doppelagent hat begriffen, dass man ihm heute Nacht an den Kragen will, und schlüpft still und leise aus der Bar in die Dunkelheit hinaus. Doch der Agentenclan hat bemerkt, dass ihr Vogel ausgeflogen ist, und nun springen sie von ihren Hockern auf, ziehen ihre Revolver und stürmen ihrer "Beute" hinterher.
Draußen, auf einer menschenleeren, gesichtslosen Straße in der Anonymität einer nächtlichen Großstadt, rennt der Verfolgte um sein Leben und schlängelt sich durch Passagen und stille Winkel, um seine Spur zu verwischen.
Doch wie geübte, erfahrene Spürhunde bleiben ihm seine Verfolger ebenso geschickt wie unerbittlich auf den Fersen und folgen ihm, egal, wohin er sich wendet, durch Seitenstraßen und -gassen, treppauf und treppab, in alle Ecken und Nischen.
Am Ende aber gelingt es dem "Maulwurf", seine Jäger hinter sich zu lassen. Plötzlich, mit einem jähen Wischer, ist er im Dunkel der Nacht verschwunden, bevor er in Schussweite gerät....
Kurt Weill und Bertolt Brecht, "Seeräuber-Jenny" und "Bilbao Song"
Sowohl ersteres als auch letzteres Lied hängen mit zwielichtigen Kneipen und dem Gangstermilieu zusammen. Eine Sängerin, die an Songs dieser Art herangeht, sollte meines Erachtens etwas Raues, Dunkles und Lässiges in ihrer Stimme haben wie eine Gangsterbraut, die mit allen Wassern gewaschen ist, die Spielregeln ihres Metiers kennt und sie kühl und abgebrüht anwendet.
Man kann aus der "Seeräuber-Jenny" viel herausholen: Ironie und den stillen, mühsam unterdrückten Triumph einer unterschätzten Frau, die ein entscheidendes As im Ärmel hat, das sie jetzt noch nicht ausspielt; den Zigarettenqualm und Alkoholdunst in einer Bar zu später Stunde; und dann ihren ohne Skrupel und Reue ausgelebten Triumph am Ende des Songs.
Beim "Bilbao Song" ist die Atmosphäre und Umgebung dieselbe, die Stimmung allerdings eine andere: Hier träumt jemand von früheren Zeiten, in denen es schlichter, ärmlicher und schmutziger und zugleich echter, ehrlicher und ungeschminkter zuging als in der Gegenwart; sprich, dieser Song spricht eher von Wehmut und Nostalgie.
Doch während die Pianistin eine angemessene Stimmungskulisse schuf und sie durchgängig zu halten verstand, lag das, was die Sängerin aus diesen beiden Songs machte, nach meinem Empfinden kilometerweit neben der Spur: Für mich hatte ihr Vortrag etwas Sprödes und Kühles, als hätte sie sich mit diesen Songs einen Scherz erlauben wollen, der ihr aber nicht gelang...
Frederick Loewe, "Almost Like Being in Love", Roy Hargrove "Top of my Head" und Roy Turk und Fred Ahlert, "Mean to Me" für Trompete, Klavier und Bass
Zum Ende des Konzerts kam der absolute Höhepunkt des Abends, als drei Jazzer zeigten, was sie aus ihren Instrumenten herausholen können:
ein Trompeter, der mal klar, kühl und präzise intonierte, mal in sanftes weiches Schwelgen überging; eine Pianistin, die auf den Tasten ihres Flügels tanzte, galoppierte und synkopierte, was das Zeug hielt, und ein Gitarrist, der seine E-Gitarre auf Bass umfunktionierte und für ein sattes, knackiges, federndes Rhythmusgerüst sorgte.
Jeder dieser drei Musiker zeigte, wie virtuos und lässig er sein Instrument beherrschte und die Gelegenheit genoss, sein Können zu präsentieren und seinem Spiel freien Lauf zu lassen!