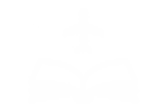Zwei Kinder gehen verloren und werden gefunden
Einmal mehr ist Heiligabend. Konrad und Sanna sind inzwischen elf und neun Jahre alt, und in diesem Jahr sollen beide ihre Großeltern zum ersten Mal alleine besuchen. Der Tag verspricht klar aber kalt zu werden, und die Mutter schärft ihren beiden Kindern ein, dass die Sonne früh untergehen wird. Deshalb sollen sie bei ihren Großeltern nicht lange verweilen und auf dem Rückweg nicht trödeln, damit sie vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause sind.
Als Konrad und Sanna zu ihrer Wanderung aufbrechen, herrscht strahlender Sonnenschein und klares Wetter; doch gegen Mittag überzieht sich der Himmel mit einer milchweißen durchscheinenden Schicht. Da die beiden Geschwister oft genug mit ihrer Mutter über den Hals gegangen sind und den Weg ebenso wie die Gegebenheiten der Natur kennen, marschieren sie zügig und unbeschwert voran und erreichen nach drei Stunden wie geplant um die Mittagszeit Millsdorf und das Haus ihrer Großeltern.
Doch kaum sind Konrad und Sanna in der warmen Stube angekommen, mahnt ihre Großmutter, dass sie nach dem Mittagessen gleich aufbrechen müssen, weil es heute noch schneien wird.
Als die Färberin ihren Enkelkindern den Sack mit den Weihnachtsgeschenken überreicht, weist sie auf eine Thermoskanne mit starkem Kaffee hin, der für ihre Tochter bestimmt ist, damit sie über die Feiertage einmal diesen besonders stärkenden und wärmenden Tropfen genießen kann.
Als sie sich von ihren Großeltern verabschieden, bekommt Konrad noch eine schnee- und regenabweisende Winterjacke und Sanna ein großes Tuch aus dicker weicher Wolle angezogen, dann ziehen sie los.
Konrad und Sanna wissen, dass sie von Millsdorf ein gutes Stück bergauf gehen müssen, bis sie den Hals erreichen und auf der anderen Seite ins Tal nach Gschaid hinunter gelangen, und kennen den Weg. Bald beginnt es zu schneien, erst in einzelnen kleinen Flocken, die bald größer werden und schließlich unablässig vom Himmel auf sie niederrieseln... Doch es ist und bleibt windstill, so dass sich der Schnee mild und nicht wirklich kalt anfühlt. Im Gegenteil; dadurch, dass er sich dicht und gleichmäßig auf den Mänteln und Tüchern der Kinder niederlässt, sorgt er für ein kleines kälteisolierendes Polster.
Doch bald deckt der Schnee sowohl den Weg als auch die vertrauten Wahrzeichen zu, die sonst ihren Weg begleiten. Konrad und Sanna wissen, dass sie bergauf gehen müssen, sehen aber in der dichten weißen Schicht, die alles überzieht, nicht den Wegweiser, dem sie folgen müssen, um an der richtigen Stelle über den Hals ins Tal hinunter zu gelangen.
Und so kommen die beiden Geschwister vom Weg ab und gelangen über die Baumgrenze hinaus und ins ewige Eis des Gletschers unter dem Gipfel des Bergmassivs.
Auf ihrem Weg über die Eisbrocken und -blöcke bricht bald die Dunkelheit herein, und Konrad bemerkt, wie still seine Schwester auf einmal wird und wie langsam und mühselig ihre Schritte sind. Ihm wird klar, dass sie in der Dunkelheit bald nicht mehr weitergehen können und die Nacht auf dem Berg verbringen müssen. Weiterzugehen wäre zu gefährlich, weil sie etwaige Felsspalten und Riffkanten, die sich unter ihren Füßen auftun, dann nicht mehr sehen.
Also müssen sie auf dem Berg übernachten und warten, bis der Morgen kommt, weil sie sich bei Tageslicht orientieren und vor allem sehen können, wohin sie treten. Nur wo?
Zu ihrem Glück stoßen Konrad und Sanna auf eine große offene Gletscherhöhle, in der sie vor weiterem Schneefall und ein Stück weit auch gegen die nächtliche Kälte geschützt sind. Die beiden Kinder schütteln den Schnee von ihren Kleidern und lassen sich für die Nacht in dieser Höhle nieder.
Konrad bemerkt, dass Sanna neben ihm immer stiller wird, und er weiß: Sie darf auf keinen Fall einschlafen! Denn der Schlaf ist der Vorbote des Todes durch Erfrieren... Einige Male gelingt es ihm, Sanna wachzurütteln, bis sie mit Nachdruck erklärt, dass sie nicht mehr kann und nur noch schlafen will..
Ihm fällt ihm Thermoskanne mit dem Kaffee ein, den ihre Großmutter ihnen heute Mittag mitgegeben hat. Es gelingt Konrad, Sanna zuzureden und sie zu bewegen, ein paar Schlucke von dem heißen starken Kaffee zu trinken, und sie erwärmt und belebt sich zusehends. Beide stehen auf und stampfen und reiben ihre Glieder warm, so gut es gehen mag.
Und so halten sich die beiden Geschwister mit dem Kaffee aus ihrer Thermoskanne wach. Dennoch hätte es geschehen können, dass Konrad und Sanna in dieser Nacht eingeschlafen und erfroren wären, wenn das beständig wandernde und sich dabei vom Grat lösende Eis des Gletschers nicht hin und wieder heftige Knallgeräusche von sich gegeben hätte, die sie jedes Mal aus dem Dämmerschlaf rissen, und wenn der aufklarende Nachthimmel mit dem Schauspiel seiner Polarlichter sie völlig nicht in ihren Bann gezogen hätte.
Um Mitternacht hören beide aus den tiefen Tälern Kirchenglocken läuten. Und so erleben sie die Heilige Nacht beim Klang der Glocken und umweht von den grünen Schleiern der Polarlichter am Himmel, der für sie zum Greifen nahe herangerückt ist. Eine Nacht, einsamer und zugleich heiliger als alle Heiligen Abende, die sie bisher erlebt haben, fern von den Menschen, allein mit dem Berg und der schweigenden, übermächtigen Natur, in der sie gestrandet sind..
Als der Tag anbricht und die Sonne aufgeht, sehen Konrad und Sanna sich um. Auf einmal meinen sie, unten im Tal ein Licht zu sehen. Von einer Fackel? Oder ist es nur die Reflektion eines Sonnenstrahls?
Nein, dort drunten tanzt und zuckt eindeutig das Licht einer Fackel! Und zu diesem Licht gesellen sich mehrere!
Die beiden Kinder beginnen zu schreien, um sich bemerkbar zu machen. Sie schreien, was ihre Kehlen und Lungen hergeben, wieder und wieder.
Und dann antworten ihnen von unten die Stimmen von Menschen. Menschen, die sich ihnen nähern, die auf dem Weg zu ihnen sind! Bald werden sie zu ihnen heraufkommen und sie von diesem Berg herunterholen...
Während Konrads und Sannas Eltern in Gschaid festgestellt haben, dass ihre Kinder nach Einbruch der Dunkelheit noch nicht zurück sind, regte sich in ihren Großeltern in Millsdorf angesichts des Schneefalls, der früher eingesetzt hat als erwartet, die Befürchtung, dass Konrad und Sanna im Schneetreiben vom Weg abkommen und die Orientierung verlieren könnten.
Ohne lange zu überlegen, trommeln die Eltern in Gschaid und die Großeltern in Millsdorf alles zusammen, was mobil ist und Erfahrung im Bergsteigen hat. Mit Leitern, Seilen und Fackeln versehen ziehen die Bewohner beider Dörfer los, um nach den Kindern zu suchen.
Auf Höhe des Halses treffen die Gschaider und Millsdorfer zusammen. Ohne Getue und Gehabe besprechen sie sich und stimmen ihre Vorgehensweise ab:
Jedes Dorf soll seine Seite des Berges absuchen, und der Suchtrupp, der die Kinder findet, soll sie zur Hütte auf der Süderalpe bringen und dort seine Fackel entzünden. Sobald vor der Hütte die Fackel auflodert, sollen sich alle Gschaider und Millsdorfer dort versammeln.
Keiner übt sich mehr in Zurückhaltung oder zeigt Standes- oder Gelddünkel. Es geht um zwei Kinder, die verloren gegangen sind und die alle lebend zurück haben wollen!
Als nach dieser langen Nacht am frühen Morgen eine der Suchmannschaften die Schreie der Kinder hört, sie aus ihrer Gletscherhöhle holt und in die Hütte auf der Süderalpe bringt; als die Eltern ihre Kinder und die Großeltern ihre Enkel wieder haben und feststellen, dass sie die Nacht auf dem Berg lebend überstanden und keine Schäden davongetragen haben; als sich die Suchtruppen aus Gschaid und Millsdorf in und an der Hütte versammeln, zieht der Färber aus Millsdorf im Namen aller sein Fazit:
Konrad und Sanna sind Kinder aus Gschaid und Millsdorf und gehören in beide Dörfer!
Und so geschieht es an diesem Weihnachtsmorgen, der zu einem guten Ende geführt hat, dass nicht nur Eltern und Schwiegereltern, sondern die Bewohner zweier Dörfer zueinander finden.
Alle, die diese Heilige Nacht und diesen Weihnachtsmorgen erlebt haben, haben bewiesen, dass sie fähig sind, sich einander von Mensch zu Mensch anzunehmen und nach den Gesetzen der Menschlichkeit zu handeln.
In diesem Sinne wünsche ich all meinen Leserinnen und Lesern nah und fern frohe und gesegnete Weihnachten und ein gesundes, gutes und glückliches neues Jahr!